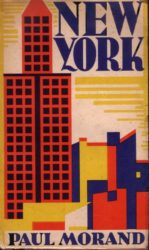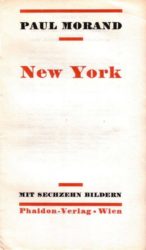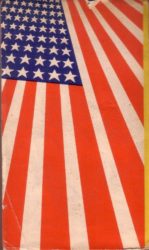Saturn-Verlag (Phaidon Verlag) (Wien)[1]
- Die Produktion
- Phaidon-Verlag
- Die Produktion
- Anmerkungen Saturn Verlag
- Anmerkungen Phaidon Verlag
- Ergänzungen zur Buchveröffentlichung von 1985

Am 13. März 1922 suchte der am 5.9.1898 in Wien geborene Dr. Fritz Ungar bei der Korporation um eine neue Konzession zum Betrieb einer „Verlagsbuchhandlung“ in Wien 2., Zirkusgasse 34 an. Im entsprechenden Protokoll liest man: „Die Firma wird lauten ,Euphorion‘-Verlag.“ Allem Anschein nach wurde das Ansuchen genehmigt. Wie es zur Firmabezeichnung kam und ob der „Euphorion“-Verlag überhaupt tätig wurde, läßt sich heute nicht mehr nachweisen.[2] Es scheint allerdings festzustehen, daß Dr. Fritz Ungar gegen Ende 1922 – inzwischen waren Dr. Béla Horovitz und Ludwig Goldscheider als stille Teilhaber eingetreten – seine Verlagstätigkeit aufnahm.[3] Die ersten Publikationen bestanden aus einer 4bändigen Dünndruckausgabe von Shakespeares Werken und einer 2bändigen Dünndruckausgabe von Platon.
Einem Protokoll der Korporation vom 11. April 1923 zufolge lautet die noch nicht handelsgerichtlich protokollierte Firma nun „Phaidon-Verlag“. Der Name stammt von Dr. Fritz Ungar. Im Herbst bemüht sich Ungar um eine im 1. Bezirk zurückgelegte Konzession und verlegt noch im selben Jahr seine Konzession vom 2. in den 1. Bezirk (1., Schulerstraße 10). Am 4. Jänner 1924 wird dann die Firma „Phaidon-Verlag Dr. Fritz Ungar“ unter Register A, Band 12, pagina 170a ins Wiener Handelsregister eingetragen. Etwa ein halbes Jahr später, im Sommer 1924, ändert sich die Firmabezeichnung in „Phaidon-Verlag Dr. Ungar, Dr. Horovitz & Co.“ (Eintragung: 14.9.1924), denn als öffentliche Gesellschafter sind der Verleger Dr. Béla Horovitz und der Schriftsteller Ludwig Goldscheider eingetreten. Beginn der OHG: 20. August 1924. Mitte Juli des folgenden Jahres wurde dem Handelsgericht mitgeteilt, daß Ungar und Goldscheider aus der Gesellschaft ausgetreten seien und diese deshalb zu löschen sei. Der nunmehrige Alleininhaber Dr. Horovitz führte die Firma unter dem Titel „Phaidon-Verlag Dr. Horovitz“ weiter.[4]
So weit die Vorgeschichte des Saturn-Verlags und die Geschichte des Phaidon-Verlags bis Ende 1925. Die Geburtsstunde des Saturn-Verlags fiel in den März 1926:
Herr Dr. Fritz Ungar, dem Buchhandel durch seine Tätigkeit im Phaidon-Verlag Wien, bekannt, setzt nach seinem Ausscheiden aus genannter Firma die Verlagstätigkeit unter der Firma „Saturn-Verlag“, Dr. Fritz Ungar, mit dem Sitze in Wien, 1., Lichtenfelsgasse 1, fort.[5]
Der Verlag übersiedelte wenig später nach 1., Ebendorferstraße 3, um schließlich im August 1929 seinen vorerst endgültigen Verbleib in Wien 1., Teinfaltstraße 4 zu finden. Der Saturn-Verlag war zunächst nicht handelsgerichtlich protokolliert. Erst 1932 trat eine wesentliche Änderung ein. Anfang September dieses Jahres wurde nämlich eine Genossenschaft mit Sitz im Nebenhaus, 1., Teinfaltstraße 6 ins Leben gerufen. Am 14. Oktober 1932 wurde die „,Literarische Verlag“ registrierte Genossenschaft m.b.H.“ unter Gen., Band 28, pagina 243 in das Register für Genossenschaftsfirmen beim Wiener Handelsgericht eingetragen. Gegenstand des Unternehmens war: der Verlag und Vertrieb von Büchern und sonstigen graphischen Erzeugnissen, und zwar ausschließlich von solchen ihrer Mitglieder. Zu den Vorstandsmitgliedern zählten Dr. Fritz Ungar und der Bankbeamte Ludwig Anton Kritsch. Anläßlich der konstituierenden Generalversammlung der neuen Verlagsgenossenschaft am 5.9.1932 führte Berthold Rosental namens der Proponenten aus,
daß die Gründung der Genossenschaft einem dringenden Bedürfnis entspricht, da es insbesondere für einen jungen weniger bekannten Autor bei den heutigen Wirtschaftsverhältnissen nicht möglich ist, seine Schöpfungen bei einem der bestehenden Verlage unterzubringen. Es sei daher notwendig, eine Verlagsanstalt auf kollektiver Basis zu gründen, welche sich zur Aufgabe machen will, dem literarischen Nachwuchs die Möglichkeit der Entfaltung zu geben.[6]
Genau zwei Monate später (5.11.1932) erfolgte eine a.o. Generalversammlung, bei der beschlossen wurde, die Firma in „Saturn-Verlag reg. Gen.m.b.H.“ umzubenennen.[7] Das Handelsgericht lehnte zunächst das Ansinnen ab,[8] so daß die Änderung erst am 19.5.1933 ins Handelsregister eingetragen wurde.[9]
Bei der ordentlichen Generalversammlung am 10.10.1934 wurde die Bilanz für das erste Geschäftsjahr 1933 präsentiert.[10] Die Bilanz wies einen – wenn auch kleinen – Verlust auf, der auf Darlehen und diverse Verbindlichkeiten zurückzuführen war.
Am 2. August 1937 erfolgte die amtswegige Auflösung dieser Verlagsanstalt. Der Firmawortlaut war nunmehr, wie es im Handelsregister trocken heißt: Saturn-Verlag reg. Gen.m.b.H. in Liquidation. Es handelt sich hier um eine technische Panne, die die Ständestaat-Gesetzgebung begünstigte und das Genossenschaftswesen 1934 bzw. 1936 im allgemeinen Spielraum einengte. Um die staatliche Kontrolle auszuweiten, entsann man sich eines Gesetzes aus dem Jahre 1903. Stichwort: Revision bzw. Revisionsverband. 1936 „beschloß“ der „Bundestag“ ein Gesetz, wonach jede Firma aufgefordert wurde, binnen sechs Monaten, „dem Registergerichte nachzuweisen, daß sie in einen solchen Revisionsverband aufgenommen worden“ sei.[11] Widrigenfalls würde die Firma liquidiert. Das versäumte der Saturn-Verlag wohl unbewußt, wiewohl er bis März 1938 aktiv blieb.[12] Im Registerakt findet sich ein Schreiben von Ungar und Kritsch im Namen des Saturn-Verlags vom 8.6.1938, in dem um eine Streichung ihrer Namen aus dem Handelsregister gebeten wird. Im Juli 1938 „verkaufte“ Dr. Fritz Ungar den Saturn-Verlag an den einzigen „arischen“ Verlags-angestellten, Theo L. Goerlitz. (Auf die „Arisierung“ des Verlags wurde an anderer Stelle näher eingegangen.) Am 30.9.1938 wurde schließlich der „Saturn-Verlag reg. Gen.m.b.H.“ aus dem Handelsregister gelöscht.
Die Produktion
In Ermangelung von Verlagsverzeichnissen war es nicht möglich, den Produktionsumfang des Saturn-Verlags 1926-1938 genau zu bestimmen. Nachgewiesen werden konnten jedenfalls etwas mehr als 70 Titel, wobei sich auch hier kein homogenes Bild ergibt. Versucht man, einen Schwerpunkt herauszusuchen, dann scheint Lyrik den Vorzug gehabt zu haben.
Die Produktion begann im 1. Geschäftsjahr 1926 mit Übersetzungswerken. So übertrug Ludwig Goldscheider Romane von O.M. Hueffer und William J. Locke. 1930 erschienen beispielsweise Benjamin Disraelis Byron-Roman Der tolle Lord und Heimito Doderers Roman Das Geheimnis des Reichs, 1931 Disraelis Spiegel des Lebens. Eine herausragende Leistung stellt die 1933 begonnene, auf 10 bis 12 Bände berechnete Ausgabe der Gesammelten Werke Otto Stoessls dar.[13] Tatsächlich erschienen nur vier Bände:
Arkadia (1933) Schelmengeschichten (1934) Geist und Gestalt (1935) Schöpfer (1938)
Finanziert wurde diese Ausgabe durch an die 150 Subskribenten.[14]
Im Saturn-Verlag erschienen Lyrikbände von Autoren wie Ernst Waldinger (Die Kuppel, 1934; Der Gemmenschneider, 1937), Herbert Strutz (Wanderer im Herbst, 1932), Marie Weiß, Paul Pawel, Heinrich Kranz, R. Grünberg, Alfred Neumann, N.L. Wollek u.a. Mit Romanen waren u.a. folgende Autoren vertreten: Richard Kapeller, Ernst Meder, Robert Prechtl (= Robert Friedländer), Kurt Sonnenfeld, Hermynia Zur Mühlen (Reise durch ein Leben; Nora hat eine famose Idee), Stefan Pollatschek.
In der zweiten Jahreshälfte 1934 kam ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Buch auf den Markt:
Das Herz Europas. Ein österreichisches Vortragsbuch. Herausgegeben von Robert Lohan, Walther Maria Neuwirth, Viktor Trautzl. Mit einer kulturkundlichen Einleitung von Oskar Benda.
Die im Titel (er stammt wahrscheinlich vom damaligen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas) angesprochene Nähe zur Österreich-Ideologie des Ständestaats wird sowohl im Vorwort als auch im Inhalt vollauf bestätigt:
(…)
Es ist ein Vortrags- und kein Lesebuch. Auch die Prosastücke sind Rede oder „Erzählung“. Österreichischen Feiern will es Programm geben.
Drei Richtlinien waren daher bei der Auswahl maßgebend: künstlerische Qualität, Eignung zum Vortrag, deutlicher Bezug auf Österreich. (…)
Das Buch bietet Texte von Autoren, die an sich ein breites politisches und ideologisches Spektrum darstellen. Konservative, Katholische, Nationale – alle sind vertreten unter dem gemeinsamen Thema. Es nimmt Zeugnisse toter und lebender Dichter auf, läßt Ständestaatpolitiker zu Wort kommen. Insgesamt besteht das Vortragswerk aus Beiträgen von 110 Autoren. Unter den vertretenen Politikern finden sich u.a. Engelbert Dollfuß („Werdet brave Österreicher!“; „Ihr seid Österreicher!“), Kurt Schuschnigg („Der Dienst am Deutschtum“), Ernst Starhemberg („Im Dienste des deutschen Volkes“), Ignaz Seipel („Die geistige Arbeit am Wiederaufbau“), Wilhelm Miklas („Das Herz Europas“; „Musik als ein Wesensstück österreichischer Sendung“). Auch die österreichische Literatur des 19. Jahrhunderts wurde auf „Österreichisches“ abgetastet: So finden sich Beiträge von Franz Grillparzer („Lob Österreichs; Mein Vaterland“), Robert Hamerling („Ich liebe mein Österreich“), Friedrich Hebbel („Österreich“), Lenau („An mein Österreich“), Eichendorff („Vivat Österreich“), Anastasius Grün („Hymne an Österreich“) usw. Zu den weiteren „Mitarbeitern“ zählten u.v.a. Peter Rosegger, Hugo von Hofmannsthal, Richard Schaukal, Karl Schönherr, F.K. Ginzkey, Hans Nüchtern, Rudolf Henz, Enrica von Handel-Mazzetti, F. Th. Csokor, Rud. Jer. Kreutz, Oskar Maurus Fontana, Alfred Polgar, Stefan Zweig, Franz Werfel, Hermann Bahr, Felix Salten, Anton Wildgans, Karl Hans Strobl, Maria Grengg, J.F. Perkonig, H.H. Ortner.
Von der Belletristik abgesehen, war das „Programm“ des Saturn-Verlags recht bunt gemischt. Es erschienen einige Schriften von Herbert Müller-Guttenbrunn (Mensch und Erde; Weg zur inneren Freiheit), Robert L. Ripleys Unglaublich, aber wahr (1937), Grillparzers dramatisches Werk (1937) von Emil Reich, Wilhelm Müllers Bahnbrecher der Heilkunde (1935), Frau und Propaganda und Arzt und Propaganda (1936) von Wladimir Eliasberg, Wilhelm Börners Politische Zeitfragen in ethischer Beleuchtung (1936) und vieles andere mehr.
Ein Überblick über die Produktion einer Reihe von österreichischen Verlagen der dreißiger Jahre zeigt, daß Lyrikanthologien der Gegenwart sehr beliebt waren. 1934 erschien im Saturn-Verlag der 120 Seiten starke Band Österreichische Lyrik der Gegenwart. Herausgeber waren zwei Verlagsautoren: Robert Brasch und Rosa Schafer. Was an dieser Anthologie, die weder Inhaltsverzeichnis, Vorwort noch Einleitung hat, auffällt, ist die Bandbreite der vertretenen Autoren – wie im Fall des zitierten Vortragsbuchs. Es findet sich ein einziger Hinweis auf die Entstehung dieser Anthologie: „Diese Anthologie geht auf eine Anregung des Bundes junger Autoren Österreichs zurück.“ Insgesamt sind 54 österreichische Autoren vertreten:
Richard Beer-Hofmann, Gisela v. Berger, Fritz Brainin, Robert Brasch, Felix Braun, Käthe Braun-Prager, Fritz Brügel, Egon Col, Walther Eidlitz, Eugenie Fink, Arthur Fischer-Colbrie, Richard Flatter, Paul Goldscheider, Alfred Grünewald, Harald Peter Gutherz, Rudolf Henz, Martha Hofmann, Emil Arnold-Holm, Alma Johanna Koenig, Theodor Kramer, Rudolf Jeremias Kreutz, Hans Leifhelm, Walter Lindenbaum, Rudolf List, Josef Luitpold, Max Mell, Erika Mitterer, Heinz Nonveiller, Hans Nüchtern, Josef Pechacek, Alfred Pentz, Josef Friedrich Perkonig, Erwin Rieger, Max Roden, Friedrich Sacher, Maria Ditha Santifaller, Theodor Sapper, Rosa Schafer, Richard von Schaukal, Ernst Scheibelreiter, Leo Schmidl, Hans Schneider, Friedrich Schreyvogl, Roland Stern, Otto Stoessl, Herbert Strutz, Heinrich Suso-Waldeck, Kurt Tischler, Ernst Waldinger, Alfred Werner, Paul Wertheimer, Arthur Zanker, Guido Zernatto, Stefan Zweig.
Sonst hatte der Saturn-Verlag kein eindeutiges Profil als belletristischer Verlag. Von den Auflagen der Verlagswerke ist nichts näher bekannt, obwohl man durch Heranziehung von Erfahrungswerten nicht fehl in der Annahme geht, daß die Druckauflagen (vielleicht mit Ausnahme der „Österreich“-Anthologie) gering waren. Nach Einschätzung des damaligen Inhabers waren die Verlagsautoren großteils Juden bzw. Liberale, was zur Folge hatte, daß eine Anzahl von Werken vom reichsdeutschen Markt ausgeschlossen blieb. Der Verlag galt, nebenbei bemerkt, in den Augen völkischer Beobachter als „Judenverlag“.[15] Sogenannte „belastete Bücher“ spielten demgemäß auch bei der „Arisierung“ des Saturn-Verlags eine nicht unbedeutende Rolle, wie an anderer Stelle dieser Arbeit ausgeführt wurde. Das bedeutete natürlich, daß der Wert der Firma erheblich schrumpfte. Der Gründer und Inhaber Dr. Fritz Ungar führte den Verlag bis März 1938. Im Juni 1938 konnte er Österreich – ohne jede finanzielle Entschädigung für seinen Verlag – verlassen. Er ging nach New York, wo er die Frederick Ungar Publishing Co. Inc., eine der erfolgreichsten und angesehensten Verlagsunternehmungen der U.S.A., gründete und aufbaute.[16]
Phaidon-Verlag
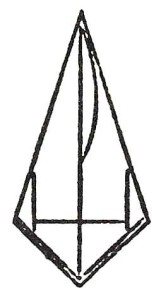
Was passierte dann nach dem „Anschluß“? Der Verlag erhielt einen kommissarischen Verwalter, richtiger: einen „wilden Kommissar“, und obwohl konkrete Unterlagen fehlen, kann man auf Grund von „Erfahrungswerten“ stark vermuten, daß der Kommissar sich einige Stunden nach dem „Anschluß“ im Verlag einfand. Er hieß Walther Scheuermann und hatte, wie an anderer Stelle dargelegt, reiche Erfahrung in der österreichischen Verlagsbranche (Rikola, Speidel etc.). Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings Verlagsdirektor und Gesellschafter der Firma „Tieck-Verlag“ (s.d.), was zu einem bitteren Streit mit seinem Kompagnon Mirko Jelusich führte, der ihm wegen seiner nunmehrigen Leitung des Phaidon-Verlags Vertragsbruch vorwarf. Die beiden gingen rechtlich und geschäftlich getrennte Wege. Obwohl mehr kommissarischer Verwalter von eigener Gnade als sonst etwas, oblag Scheuermann die Pflicht für den (streng genommen: vermeintlichen) Alleininhaber des Phaidon-Verlags Dr. Béla Horovitz die Vermögensanmeldung und für den Verlag die Bilanz-Arbeiten durchzuführen. Eine leichte Aufgabe war das nicht, zumal Horovitz im Ausland weilte und wohl nicht geneigt war, in die „Hölle“ zurückzukehren und weil das private Besitztum an Wertgegenständen usw. noch nicht bekannt war und hierüber mit Horovitz Korrespondenz geführt werden mußte. Daher hat Scheuermann die VVSt um eine Terminverlängerung für die Abgabe der Vermögensanmeldung bitten müssen. Aber schon spätestens am 11. August 1938 fand sich Scheuermann nicht mehr im Amte: er scheint abrupt enthoben worden zu sein. An seiner Statt würde – offiziell und nach dem Gesetz Nr. 80/1938 – eine Frau Irma Pasler, 7., Tulpengasse 6, zum kommissarischen Verwalter des Phaidon-Verlags bestellt. Nur: Erfahrung im Verlagsbuchhandel konnte man ihr nicht nachsagen, was aber in Zeiten wie jenen kein Hindernis war.
Die kommissarische Verwaltung gab dann doch eine Vermögensanmeldung für Horovitz ab[1] , und aus diesem Akt geht hervor, daß Horovitz‘ Haushaltseffekten (Leuchter, Gewürzbehälter, Silberlöffel etc.) oder was von ihnen nicht schon gestohlen worden war, den Weg allen jüdischen Vermögens gingen (§ 14 der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens), und zwar ins Dorotheum. Die weiteren Vorgänge um den Verlag lassen sich leider nicht genauer rekonstruieren, weil die entsprechende Handelsanmeldung (H.A. 2330/VI) zwar nachgewiesen, aber nicht aufgefunden werden konnte.
Daß in der NS-Bürokratie die rechte Hand nicht immer wußte, was die linke tat, zeigt die Tatsache, daß noch im Februar 1940 das Finanzamt Innere Stadt Ost/Reichsfluchtsteuerstelle hinter Horovitz her war!
Mittlerweilen wurde Irma Pasler vom Staatskommissar in der Privatwirtschaft und Leiter der Vermögensverkehrsstelle am 28. März 1939 die Vollmacht als Treuhänder für den Phaidon-Verlag übergeben (Eintragung: 7.4.1939). Pasler wurde dann aufgefordert, die Firma Phaidon-Verlag im Handelsregister löschen zu lassen, und dies geschah am 31. Mai 1939.
Die Produktion
Die Produktion dieses Individualverlags zwischen 1923 und 1938 läßt sich grob in zwei Phasen einteilen – eine Phase bis 1933 mit der fast ausschließlichen Beschäftigung mit (tantiemenfreier) Literatur und eine zweite nach 1933 mit dem Schwerpunkt Kunstreproduktion und Kunsthistorisches. In der Anfangsphase des Verlags wiederum (etwa 1923-25) hat der Phaidon-Verlag den Anschein eines neuen „Klassikerverlags“. Ein erstes Verlagsvorhaben war die von Ludwig Goldscheider betreute Serie der Phaidon-Drucke, die Werke „freier“ Autoren brachte: Leopold Friedrich Göckingk, William Wordsworth, Jonathan Swift, Ovid, Novalis, Meister Eckart, Goethe. Von Kleist verlegte der Verlag 1924 neben Amphitryon (Orig.-Lith. von Laszlo Gabor) und Michael Kohlhaas (Orig.-Lith. von Erica Ballin-Woltereck) auch eine Dünndruckausgabe von Kleists Sämtlichen Werken mit Textanordnung von Ludwig Goldscheider. Von Shakespeare war 1923 eine Ausgabe von Ein Sommernachtstraum erschienen, gefolgt 1924 von der Ausgabe der Sämtlichen Dramen in vier Bänden nach der Schlegel-Tieckschen Übersetzung. Der Phaidon-Verlag verlegte 1924 außerdem Schillers Die Räuber, Theodor Storms Unter dem Tannenbaum und – aus dem Rahmen fallend – Ludwig Goldscheiders Ruhe auf der Flucht. Aphorismen und Schlußreime. In den folgenden Jahren begann das Verlagsprogramm allmählich, lebende Autoren zu berücksichtigen. In dieser Übergangsphase erschien das Werk Thomas Mann. Verfall und Überwindung von Hanne Back, Übersetzungen von Samuel Butler jenseits der Berge oder Merkwürdige Reise ins Land Aipotu; Der Weg allen Fleisches), Deutsche Schriften von Martin Luther.
Ungefähr ab 1927/28 tritt eine Wende weg von den „Klassikern“ zu Gegenwartsautoren hin. 1927 erscheint das allererste Werk im Phaidon-Verlag des Lyrikers, Romanschriftstellers und Literaturkritikers Klabund (d.i. Alfred Henschke), und dieser wird echter „Verlagsautor“, indem der Phaidon-Verlag die Rechte auf seine Werke erwirbt. Für österreichische Verhältnisse dieser Zeit sind die Auflagenzahlen von Klabunds Werken beachtenswert. Sukzessiv werden seine Werke 1927-1933 – Henschke starb 1928, erst 38 Jahre alt – nachgedruckt:
1927: Das Kirschblütenfest. Spiel nach dem Japanischen. 1928: Borgia. Roman einer Familie (1931: 46.-95. Tsd.) Totenklage. 30 Sonette; 1929: Gesammelte Romane; Dichtungen aus dem Osten. Band 1 bis 3; Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen (Volksausgabe 1932); Rasputin. 1930: Gesammelte Werke in Einzelausgaben (6 Bände); Chansons. Streit- und Leidgedichte; Novellen von der Liebe; Literaturgeschichte. Die deutsche und fremde Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart (illustr. Volksausgabe im selben Jahr); Kriegsbuch. 1932: Bracke. Ein Eulenspiegel-Roman (120. Tsd.). 1933: Chinesische Gedichte. Nachdichtungen; Romane der Leidenschaft. Moreau. Roman eines Soldaten; Pjotr. Roman eines Zaren; Rasputin. Roman eines Dämons. Mohammed. Roman eines Propheten. (1.-17.Tsd. der Volksausgabe) (zuerst erschienen 1915, 1923, 1917)
1928 erschien ein Essaywerk von Arnold Zweig Herkunft und Zukunft sowie der Gedichtband Die Harfe Gottes von Hugo Salus, Ludwig Batos Die Juden im alten Wien, Herbert Eulenbergs Die letzten Wittelsbacher und Alexander Gleichen-Russwurms Novellen Im grünen Salon. Im Todesjahr Hofmannsthals erschien dessen Unterhaltungen über literarische Gegenstände, Knut Hamsuns Der wilde Charakter, Heinz Liepmanns Roman Nächte eines alten Kindes und Richard Spechts Die Nase des Herrn Valentin Berger. Tragikomödie eines Wiener Filmschauspielers und Die Probeehe von Rudolf Urbantschitsch.
1930 kam eine Reihe von bedeutenden österreichischen Autoren hinzu, vor allem in der neugeschaffenen Reihe Die Gold- und Silberbücher. Hier waren neben Klabund (3 Werke) auch Jakob Wassermann (Die Kunst der Erzählung), Hugo Hofmannsthal und Egon Friedell (Kleine Philosophie. Vermischte Meinungen und Sprüche) vertreten. Auch der Literaturkritiker Rudolf Kayser stieß zum Phaidon-Verlag und publizierte bis 1935 drei Werke (Dichterköpfe, 1930; Spinoza. Bildnis eines geistigen Helden, 1932; Kant, 1935). Daneben erschienen 1930 Werke von Robert Neumann Passion. Sechs Dichterehen; Panoptikum. Bericht über fünf Ehen aus der Zeit), Leopold Perutz (Herr, erbarme Dich meiner!, Novellen), Paul Morand, Heinz Liepmann. Auch Arthur Schnitzler war im Phaidon-Verlag mit einem Werk vertreten (Buch der Sprüche und Bedenken) wie auch der Miteigentümer des verwandten Strom-Verlags, Julius Haydu, der drei Romane im Phaidon-Verlag veröffentlichte (Roman der Sonne, 1928; Jehovas Geburt. Roman, 1930; Rußland 1932, 1932).
Bis 1933 erschienen zwar weitere Literatur und historische Werke, wie z.B. Eugen Lennhoffs Bestseller Die Freimaurer. Geschichte, Wesen, Wirken und Geheimnis der königlichen Kunst (1932) oder Friedrich Oppenheimers Roman Sarajevo – das Schicksal Europas (1931), aber ab 1933 erfolgte eine Zäsur: der Verlag geht nicht nur auf völlig unpolitische Werke über, er verlagert den Programmschwerpunkt auf Kunst und Kunstgeschichte.
Zuerst aber kurz zu den Verlagsalmanachen, die Ludwig Goldscheider herausgab: der erste Almanach nannte sich Phaidon. Ein Lesebuch, erschien 1924 (Impressum: 1925) und enthielt neben Textproben englischer, deutscher und lateinischer Klassiker auch Beiträge von Goldscheider, Hermann Hesse, Wilhelm Schäfer, Karl Adler, Rud. Alex. Schröder und Otto Stoessl. Mit einer gefälligen Aufmachung erschien dann 1928 das Phaidon Lesebuch mit Beiträgen von Hesse, Stefan Zweig, Peter Altenberg, Leo Perutz, Richarda Huch, Arthur Schnitzler, Franz Blei, A. v. Gleichen-Russwurm, Klabund. Der letzte Almanach, das Phaidon-Lesebuch auf das Jahr 1933, spiegelte wie die vorigen Lesebücher die konservative Linie des Verlags wider, der auf Klassiker bzw. auf arrivierte lebende Autoren setzte (Caldéron, Achim v. Arnim, Karl Immermann, Paul Zech, Klabund, William Blake, Theodor Mommsen, H. Hesse usw.). Wie der kurzlebige Versuch mit der Roman-Rundschau im Strom-Verlag 1929 auch zeigt, ließ Horovitz die Gegenwartsbelletristik nicht gänzlich außer acht.
Der Phaidon-Verlag, der in den 30er Jahren etwa 70% seines Absatzes in Deutschland machte und außerdem viel dort drucken ließ, nützte ab 1933 die Gelegenheit, Emigranten Unterschlupf zu gewähren, nicht aus.
In diesem Zusammenhang interessant ist der Name Joseph Roth. Es mag verwundern, daß Roth etwa in den 20er Jahren zu keinem österreichischen Verlag (außer E.P. Tal) Kontakt anknüpfte und bis auf eine einzige Ausnahme (es handelt sich nicht um eine Erstveröffentlichung) überhaupt nichts in einem österreichischen Verlag erscheinen ließ, vor allem nach 1933 nicht. Auf den Grund wollen wir hier in einem kurzen Exkurs näher eingehen. Roth, der sein Leben lang trotz beachtlicher Erfolge auf Geld- und Verlagssuche gewesen zu sein scheint, hat nach dem Biographen David Bronsen, der sich auf eine Mitteilung Oskar Maurus Fontanas in Wien beruft, (vermutlich) 1924 das Manuskript des Romans Hotel Savoy an seinen Freund Fontana in Wien, der zeitweise – wie wir gesehen haben – als Lektor bei E.P. Tal tätig gewesen ist – zur Begutachtung geschickt. Trotz Fontanas warmer Empfehlung habe Tal sich nicht geneigt gezeigt, „das Werk eines jungen und unbekannten Autors zu veröffentlichen“. [2] Es muß als Ironie aufgefaßt werden, daß dieses Werk zwar 1924 im Berliner Verlag „Die Schmiede“ erstveröffentlicht wurde, in 2. Auflage aber in Österreich und zwar im Phaidon-Verlag erschien.
Dennoch brach Roth seinen Kontakt zu E.P. Tal nicht ab. Das bezeugen einige Stellen in Briefen Roths an Stefan Zweig (z.B. 10.7.1928: „Ich bin dort [in Wien] durch die Adresse des Herrn E.P. Tal Wien VII. Lindengasse 4 vorläufig zu erreichen.“ (op. cit., S. 133); s. auch 26.12.1928: „Ich fahre morgen für zwei Tage nach Wien, wo meine ständige Adresse: der E.P. Tal-Verlag Lindengasse 4. VII. ist.“ (S. 139). Der Herausgeber der Roth-Briefe deutet nicht im leisesten an, worum es hier gegangen sein kann, wie er den Benützer überhaupt oft im Stich läßt, wenn es in Briefen „Roman“ oder „Buch“ heißt.
Was der Roth-Forschung bislang entgangen ist, ist die Tatsache, daß das 1930 im Münchner Verlag Knorr & Hirth erschienene Buch Panoptikum. Gestalten und Kulissen unter einem anderen Titel bei Tal hätte erscheinen sollen. In dem Bericht über seine „Reise zu den Wiener Verlegern“, der am 14. März 1930 in der Literarischen Welt publiziert wurde, schreibt Willy Haas nämlich: „Tal bringt in der nächsten Zeit heraus: ein Buch unseres Mitarbeiters Joseph Roth, ,Seine K. und K. Apostolische Majestät“ (…).“ Schon am 4.6.1929 hatte Roth an Zweig geschrieben: „Schließlich möchte ich Sie fragen, ob es Ihnen angenehm wäre, jenen Artikel über Franz Joseph – in meinem Buch wird es ein Kapitel sein – mit einer Würdigung für Sie gedacht zu sehen.“ [3] Warum Roth von Tal wegging, ist noch nicht geklärt.
Den Kontakt Roths zum Phaidon-Verlag kann ohne weiteres Stefan Zweig vermittelt haben. [4] Roth an Zweig am 22. September 1930:
Herr Dr. Horovitz vom Phaidon-Verlag macht mir den Vorschlag, für RM 3000.- ein Buch zu schreiben. Es soll heißen: Der Orientexpreß, und den Zug, seine Passagiere, ihre Hotels und Aufenthaltsorte behandeln. Ich verhandelte mit Kiepenheuer, damit er mir diesen Seitensprung gestattet, da er selbst mir doch jetzt kein Geld mehr geben kann (…). Für den Fall, daß ich mit Dr. Horovitz abschließen kann, habe ich einigermaßen 2½ Monate versorgt, aber dann muß ich wieder arbeiten, denn er will das Buch am 1. März. (op. cit., S. 179)
Wie aus einem Schreiben an Zweig am folgenden Tag hervorgeht, willigte Roth mit Horovitz in einen Vertrag ein, nur wurde daraus kein Roman Der Orientexpreß, sondern die 2. Auflage des Romans Hotel Savoy. Es scheint aber nicht ausgeschlossen zu sein, daß Horovitz auch den 1924 im Verlag Die Schmiede erschienenen Roman Die Rebellion wieder auflegen wollte. In einem Brief Roths aus Paris vom 18.2.1933 heißt es z.B.:
Da Sie für die Rebellion mindestens 1000 Mark bezahlt haben, verlange ich Nachzahlung von nur 100 Schilling für Savoy. Unter uns: Rebellion ist im Druck. Für Ihren Hereinfall noch 20 Schilling. Wollen Sie jetzt den Erfolg meiner nächsten streng reaktionären Bücher verderben? (op. cit., S. 251)
Bronsen geht auf solche prinzipiellen Fragen nicht ein, und der Kommentarteil zur Briefausgabe ist in solchen Fragen unergiebig. Hotel Savoy im Phaidon-Verlag wurde übrigens in Leipzig bei Oskar Brandstätter (Abteilung Jakob Hegner) gedruckt. [5]
Aber kehren wir nun zum Ausgangspunkt dieses Exkurses zurück. Im eben zitierten Brief Roths an Béla Horovitz vermag der Briefschreiber nach der Machtübernahme Hitlers und vor den Bücherverbrennungen die kommenden Entwicklungen vorauszusehen!
Bereiten Sie sich mit aller nötigen Diskretion darauf vor, daß Sie bald mehrere deutsche Autoren bekommen können. Die jüdischen Verleger in Deutschland werden zusperren. (op. cit., S. 251)
Mit letzterem hatte Roth langfristig recht, nur im Fall Phaidon-Verlag war ein Unterschied zwischen „bekommen können“ und „aufnehmen wollen“. Horovitz war bei weitem nicht der einzige österreichische Verleger, der „vorsichtig“ wurde und den Emigranten, wenn überhaupt, nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüberstand. Das freundschaftliche Verhältnis Roths zu Horovitz im Jahre 1933 verwandelte sich ganz allgemein in einen tiefen Haß, in Verachtung „jüdischen“ Verlegern in Österreich bis 1938 gegenüber.
Die Briefe Joseph Roths enthalten eine Fülle von Bemerkungen zu österreichischen Verlegern der 30er Jahre. Seine Einstellung verwandelte sich, wie gesagt, von Freundschaft zu Feindschaft, egal ob Zsolnay, Horovitz, Tal oder Reichner, dem Wiener Verleger Stefan Zweigs, bei dem auch Roth hoffte unterzukommen. [6]
Unterließ es Roth in seiner Kritik 1937 im Christlichen Ständestaat, Namen zu nennen, so hat er sich in einem Brief an Stefan Zweig am 7.9.1937 diesen Zwang nicht mehr auferlegt. Der Vorwurf Roths an die jüdischen Verleger in Österreich: sie hätten sich mit Hitler-Deutschland arrangiert. Hier einige Auszüge, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen:
Also schreibe ich Ihnen jetzt schon über meinen Aufsatz im „Christlichen Ständestaat“, den Sie beanstanden, ich verstehe nicht, warum. Ich „adoptiere“ nicht die Unterscheidung zwischen christlichen und jüdischen Verlegern; sondern die jüdischen Verleger in Österreich haben die Unterscheidung Hitlers zwischen arischen und nicht arischen Autoren, zuerst adoptiert. Diese Verleger sind es, die die Discriminierung vorgenommen haben, nicht ich. Es ist meine Pflicht, diese Juden, die Goebbels‘ Knechte sind, zur Ordnung zu rufen. Dieser Zsolnay, der Horovitz, die blöde Kuh Tal, Ihr frecher Verleger Reichner, der die Chuzpe hat, Sie, ausgerechnet Sie, in Deutschland zu inserieren: sie verderben noch die paar „arischen“ Schriftsteller und Verleger. Denn diese berufen sich, mit Recht, darauf, daß sogar die Juden den Anforderungen der Reichs-Schrifttumskammer nachkommen. Im Gegenteil: es ist meine Pflicht, diesen Juden, die das Unheil vergrößern, das Handwerk zu legen. Ich werde es tun. (…)
Ein jüdischer Verleger, der ein Buch nur deshalb nicht bringt, weil es keinen Absatz in dem Reich Goebbels‘ hat; der nur jene Bücher bringt, deren Absatz nicht gefährdet ist im Reiche der Antisemiten: solch ein Verleger ist der letzte aller Würmer, und ich werde selbstverständlich immerdar trachten, ihn zu zerbrechen. Im Übrigen: tua et mea res agitur. Wir können nicht zulassen, daß Arschlecker, wahrhaftige Saujuden, Chuzpe-Jüngels und Trauerweiden jüdischer Provenienz mich nicht veröffentlichen, weil ich Goebbels nicht gefalle. Wir haben genug „arische“ Antisemiten. Wir brauchen keine jüdischen. Solange es mir möglich ist, diese zu schädigen, werde ich es selbstverständlich tun: mit Wonne. Um sie zu schädigen, werde ich mich sogar mit „arischen“ Antisemiten verbünden. Ein Nichtjude, der Goebbels gehorcht, ist nur ein armes Schwein. Aber ein Jude, Verleger in Wien, der mich ablehnt, weil ich Goebbels nicht gefalle, ist ein gemeiner Schweinehund. (…) die Witwe Tal, die sagt: wir müßten alle unter Pseudonym von vorne anfangen; jener Horovitz, der sich „Phaidon“ nennt; der Klosett-Fabrikant Zsolnay, dessen Werfel gestiegen sind; Ihr Chuzpe-Reichner, den Sie, – für mich unverständlich – wie den Insel-Verlag behandeln: diese Knechte Pharaos, diese Verräter Mosis, diesen Scheißdreck verteidigen Sie, jüdischer Dichter, vor mir? Sie, mein Freund, der Sie Gott im Herzen haben, und den Sie lange Zeit vergessen hatten und den Sie im Begriff sind, wieder zu lieben? Ich hätte eher gedacht, daß Ihnen mein Artikel Freude macht.
(…)
Der Schlag soll sie treffen, und ich werde versuchen, dem Schlag zuvorzukommen. (…) (op. cit., S. 508 f.)
Horovitz machte zwar eher selten, aber doch „Literatur“, die über jeden Verdacht erhaben war, die NS-Zensur zu interessieren: Rudolf Borchardt (Englische Dichter, 1936 oder Die schönsten Gedichte der Weltliteratur. Ein Hausbuch der Weltlyrik von den Anfängen bis heute, 1936), Hesiod: Sämtliche Werke, (1936), Guy de Maupassant (1936), Francesco Petrarca (1935), Eckart v. Sydow (Dichtungen der Naturvölker), Karl Vossier (Romanische Dichter, 1936) usw. Andererseits waren die vielen Werke zur Theater- und Kunstgeschichte ebensowenig politisch und verdächtig: etwa die mehrsprachige Kunstzeitung Artibus, mehrere Werke von Jakob Burckhardt wie Rubens aus der sehr erfolgreichen und preiswerten Reihe Große illustrierte Phaidon-Ausgabe) ,[7] Die Zeit Konstantins des Großen, Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Werk über Paul Cézanne, Hermann Grimms Leben Raphaels (1933), Joseph Gregors Weltgeschichte des Theaters (1933) und Shakespeare. Der Aufbau eines Zeitalters (1935), Hans Tietzes Meisterwerke europäischer Malerei in Amerika (1935) und Tizian. Leben und Werk usw.
Der Neid und der Antisemitismus führten dazu, daß der Phaidon-Verlag, der – waren seine großen illustrierten Ausgaben auch für Durchschnittsbemittelte erschwinglich – im Reich ein großes Geschäft machte und aufwendig im Börsenblatt annoncierte, ab 1936 mit Schwierigkeiten kämpfen mußte. Da dieser Fall an anderer Stelle ausführlich behandelt wird, mag es uns hier begnügen, einige zeitgenössische Zeugnisse zur Rezeption des Phaidon-Verlags anzuführen. In Heft 2 der Neuen Literatur vom Februar 1937 stellt Will Vesper fest, daß „die jüdische Herrschaft in Deutschland (…) beseitigt“ sei (S. 103) und daß man nun „die jüdischen Verlage des Auslandes“ schärfer beobachten müsse; so laut Vesper –
Den Phaidon-Verlag, ein [sic!] Aasgeierverlag, der die Toten, die honorarfreie Kunst, Dichtung und (vielfach veraltete) Wissenschaft des Abendlandes immer noch einmal mit Warenhausgeist ausschlachtet; (S. 104)
Ähnliches konnte man einige Monate später in einer Wiener Publikation lesen:
Es folgt der Phaidon-Verlag, ebenfalls ein rein jüdisches Unternehmen. Beide Verlagsfirmen schielen heute nach dem deutschen Geschäft aus dem Wiener Drahtverhau ihres Unterstandes. Daher hält sich etwa der Zsolnay-Verlag als einen seiner Lektoren dermalen einen nichtjüdischen Herrn und daher bringt der Phaidon-Verlag die alten deutschen Kulturgüter auf den Büchermarkt unter oft geschickter Tarnung ihrer Herausgebermarke.“ [8]
Mit gründlicher Verspätung erreichte auch Will Vesper die Nachricht vom Eigentümerwechsel im Phaidon-Verlag. In Heft 1 vom Jänner 1939 kommt Vesper wieder auf Grundsätzliches zu sprechen:
Der bekannte Wiener Judenverlag Phaidon, der mit seinen Warenhaus-Schinken, in denen er hauptsächlich honorarfreie Werke oder veraltete wissenschaftliche Werke von einstigem Ruf ausschlachtete, den deutschen Büchermarkt überschwemmte, ist in den Besitz der englischen Verleger George Allen and Unwin, London, übergegangen und erscheint wieder auf dem deutschen Markt. Schon prangen in deutschen Buchschaufenstern Plakate in großen Lettern: „Phaidonbücher wieder lieferbar!“ Dabei scheint es weiter nicht zu stören, daß sicherem Vernehmen nach der bisherige Besitzer des Phaidon-Verlages, der Jude Dr. Horovitz, von den englischen Verlegern mit „übernommen“ worden ist, so daß praktisch die Sache so liegt, daß ein Jude von London aus deutsche Bücher nach Deutschland verkauft. Warum müssen überhaupt deutsche Bücher in London verlegt werden? Der deutsche Verlag kann alle deutschen Buchbedürfnisse selber decken, er braucht dazu keinen Engländer und am allerwenigsten emigrierte Juden. Mit der Förderung des Phaidon-Verlages hilft der deutsche Buchhandel dem Juden, der durch die Hintertür entfloh, nun, als ehrenwerter „englischer“ oder „amerikanischer Kaufmann“ durch die Vordertür wieder hereinzukommen. Wir sind keine englische Verlegerprovinz. Verlege jeder in seinem Land! (S. 44)
Die Bücher aus dem Phaidon-Verlag hatten aber zuvor nicht nur in den radikalsten NS-Blättern im Reich höchste Anerkennung gefunden, auch in Österreich wußte man den Verlag und seine Bücher zu schätzen. Von katholischer Seite erschien z.B. folgendes Urteil im Christlichen Ständestaat:
Es handelt sich durchwegs um Werke, die einer kultur- und bildungsentfremdeten Zeit das unvergängliche Reich des Geistes sichtbar machen. Hier wird unstreitig eine Mission erfüllt.
Ein Problem aber ist der Erfolg. Die Bücher des Phaidon-Verlages erscheinen in so rascher Folge, daß an ihrem Erfolg nicht gezweifelt werden kann. Öffnet sich hier der Weg zu einem optimistischen Ausblick? Haben wir die Zeit unterschätzt? Mitnichten. Zweifellos beruht der Erfolg der Phaidon-Bücher – abgesehen von dem guten Geist – nicht auf dem Wert der herausgegebenen Werke an sich, sondern auf ihrer Ausstattung. Die Psychologie der Zeit wurde hier richtig durchschaut. Ihr sind Bilderbücher lieber als Lebensbücher. Der Trick, diese als jene zu verkleiden, ist nicht übel. Er dient einem guten Zweck und die Verkleidung gewährt einen angenehmen Anblick. [9]
Wie schon in der Polemik Vespers angedeutet, arbeitete Horovitz zunächst in Zusammenarbeit mit Allen & Unwin, dann selbständig. 1944 erfolgte die Gründung der dem Studium jüdischer Philosophie gewidmeten „East & West Library“. Durch die Oxford University Press New York wurde die Verbindung mit Amerika hergestellt. Während eines Aufenthalts in New York erlitt Horovitz einen Herzinfarkt und starb am 8. März 1955 im Alter von 56 Jahren. Er hinterließ eine Frau, Lotte, einen Sohn, zwei Töchter, einen Bruder und eine Schwester. Horovitz‘ Jugendfreund und langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ludwig Goldscheider, starb 1973 in London. [10]
Anmerkungen zum Saturn-Verlag
[1] Quellenhinweise: Handelsgericht Wien. Registerakt Gen. 28, 243 (WrStLa); Akt Gremium/Saturn-Verlag; schriftl. Befragung Dr. Frederick Ungar, New York; Handelsgericht Wien. Registerakt Reg. A 12, 170a (Phaidon-Verlag) (WrStLa).
[2] Frederick Ungar kann sich heute verständlicherweise nicht an alle Einzelheiten erinnern.
[3] Mitteilung Frederick Ungars an den Verf. 4.5.1981.
[4] Zur Biographie Dr. Béla Horovitz (18.4.1898, Budapest-8.3.1955, New York) siehe u.a. WZ, 8.5.1955, IV; New York Times, 8.3.1955, S. 27, Sp. 4;Das Antiquariat (Wien), XI. Jg., Nr. 9/10, Mai 1955, S. 120; Flugblatt Buchhandlung Wolfrum Wien vom Herbst 1980, „Geschichte der ,Phaidon Press'“ (sehr fehlerhaft!). Siehe außerdem die Ausführungen über den Strom-Verlag.
[5] Anzeiger, Nr. 12, 19.3.1926, S. 82.
[6] Protokoll der konstituierenden Generalversammlung im Registerakt. Sowohl Dr. Ungar als auch der Sohn Otto Stoessls, Prof. Dr. Franz Stoessl, reagierten spontan auf die Anfrage des Verf. bezüglich des Saturn-Verlags als Genossenschaftsverlag in der Weise, daß der Saturn-Verlag keine Genossenschaft gewesen sei. Die Unterlagen im Registerakt zeigen aber unmißverständlich, daß der Verlag eine Genossenschaft war.
[7] Anwesende bzw. vertretene Mitglieder der Genossenschaft: Berta Ungar, Hans Albert Ungar, Dr. Fritz Ungar, Ludwig Anton Kritsch, Berthold Rosenthal, Dr. Robert Grossbard, Carl Grossbard, Gustav Rapaport.
[8] Trotz schriftlichen Verzichts von Dr. Fritz Ungar.
[9] Anzeiger, 74. Jg., Nr. 23, 10.6.1933, S. 105.
[10] Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10.10.1934, im Registerakt.
[11] BGBl. 1936, Stück 93, Nr. 386, S. 920-921; BGBl. 1937, Stück 47, Nr. 165, S. 617.
[12] Frdl. Mitteilung Dr. Frederick Ungar, New York.
[13] Siehe FRANZ STOESSL, Otto Stoessl – Ein Porträt. In: Österreich in Geschichte und Literatur, 17. Jg., 1973, Heft 4, S. 231-250.
[14] Eine entsprechende Liste findet sich im Band Schelmengeschichten. Wien: Saturn-Verlag, 1934 (Der Gesamtausgabe zweiter Band).
[15] Siehe KARL INHAUSER, Wer verlegt heute wen? In: Österreichische Volkpresse (Wien), 12.6.1937, S. 4.
[16] Näheres zu seiner Tätigkeit in den USA siehe: Who is who in America. Aus Anlaß seines 85. Geburtstags erschien im Anzeiger des österreichischen Buchhandels, Nr. 22, Mitte November 1983, S. 253, eine relativ ausführliche Würdigung.
Anmerkungen zum Phaidon-Verlag
[1] AVA, BMfHuV, VVSt, V.A. 66.527.
[2] Joseph Roth. Briefe 1911-1939. Hg. und eingel. von HERMANN KESTEN. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970, S. 249 f.
[3] Ausnahmsweise klärt der Herausgeber den Benützer darüber auf, welches „Buch“ gemeint ist. Siehe ebda., S. 153 bzw. S. 557. Der erwähnte Artikel Roths war am 6.3.1928 in der Frankfurter Zeitung erschienen.
[4] Zweig war 1929 in der Roman-Rundschau vertreten.
[5] Dies ist ein möglicher Hinweis auf das Erscheinungsjahr dieser Ausgabe mit Federzeichnungen von Franz Howanietz. Daß das Werk „vermutlich 1925“ erschien, halte ich für so gut wie ausgeschlossen. (Siehe die entsprechende Bemerkung in: Joseph Roth 1894-1939. Eine Ausstellung der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: Buchhändler-Vereinigung GmbH, 1979, S. 419). Dieses Buch scheint übrigens weder im DBV noch im Anzeiger auf. Wahrscheinlicher ist das Erscheinen vor Ende 1930 oder im Jahre 1931 anzusetzen. Ungeklärt ist die Briefpassage vom 18.2.1933, Horovitz habe „für die Rebellion mindestens 1000 Mark bezahlt“. Es scheint so zu sein, daß er auch für dieses Werk die Rechte erwarb.
[6] Joseph Roth. Briefe, S. 424f. An Stefan Zweig vom 21.8.1935: „Ich will Sie um eine ,efficace‘ Hilfe bitten, und zwar, ob ich nicht ein Autor des Reichner-Verlags werden könnte.“
[7] OTTO BENESCH, In memoriam Dr. Béla Horovitz. In: WZ, So., 8.5.1955, S. IV: „Die Phaidon-Bücher hatten großen Erfolg: noch nie waren früher Kunstbücher in so hohen Auflagenzahlen und so wohlfeil unter die Menge gebracht worden.“
[8] KARL INHAUSER, Wer verlegt heute wen? In: Österreichische Volkspresse (Wien), Sa., 12.6.1937, S. 4.
[9] 2. Jg., Nr. 32, 11.8.1935, S. 775: Bücher aus dem Phaidon-Verlag von O.M.F.; O.M.F. ist eine Abkürzung für Otto Maria Fidelis als Pseudonym für Otto Maria Karpfen.
[10] Im Jahre 1973 erschien in London eine Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Phaidon-Verlags bzw. der Phaidon-Press: Phaidon Jubilee 1923-1973. Hierin findet sich neben einem Überblick über die Geschichte des Verlags (The Phaidon Press, a brief history, S. 2-8) ein „Historical Catalogue 1923-1973“ (S. 9-16), also ein Verzeichnis der Verlagsproduktion während dieses Zeitraums. So umfassend dieses Verzeichnis nun sein mag, fehlt dennoch ein Gutteil der Verlagswerke, die in der vorliegenden Arbeit genannt werden, u.a. der Roman von Joseph Roth. Das Verzeichnis bietet trotz allem einen guten Einblick in die Produktion des Phaidon-Verlags.
Ergänzungen zur Buchveröffentlichung von 1985
Literatur
Saturn Verlag:
- Murray G. Hall: Verleger Frederick Ungar gestorben. 1898–1988. In: Anzeiger des österreichischen Buchhandels, 124.Jg., Mitte Jänner 1989, 1/2, S. 15.
Phaidon Verlag:
- Ernst Fischer: The Phaidon Press in Vienna 1923-1938. In: Visual Resources XV (1999), Special Issue, S. 289–309.
- Ernst Fischer: Zwischen Popularisierung und Wissenschaftlichkeit. Das illustrierte Kunstbuch des Wiener Phaidon Verlags in den 1930er Jahren. In: Kunstwerk – Abbild – Buch. Das illustrierte Kunstbuch von 1730 bis 1930. Hg. v. Katharina Krause und Klaus Niehr. München, Berlin: Deutscher Kunstbuchverlag 2007, S. 239–265.
- Anna Nyburg: ‘Hardly a trace left of Danube or Spree?’. A contribution to the study of art book publishing and illustrated book production in Britain by German-Speaking exiles from National Socialism. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 2010-2, S. 65–67.
- Anna Nyburg: Emigrés. The Transformation of Art Publishing in Britain. London: Phaidon Press Limited, 2014.
Bildergalerie
Phaidon Verlag:
- Cover Vorderseite
- Titelblatt
- Cover Rückseite